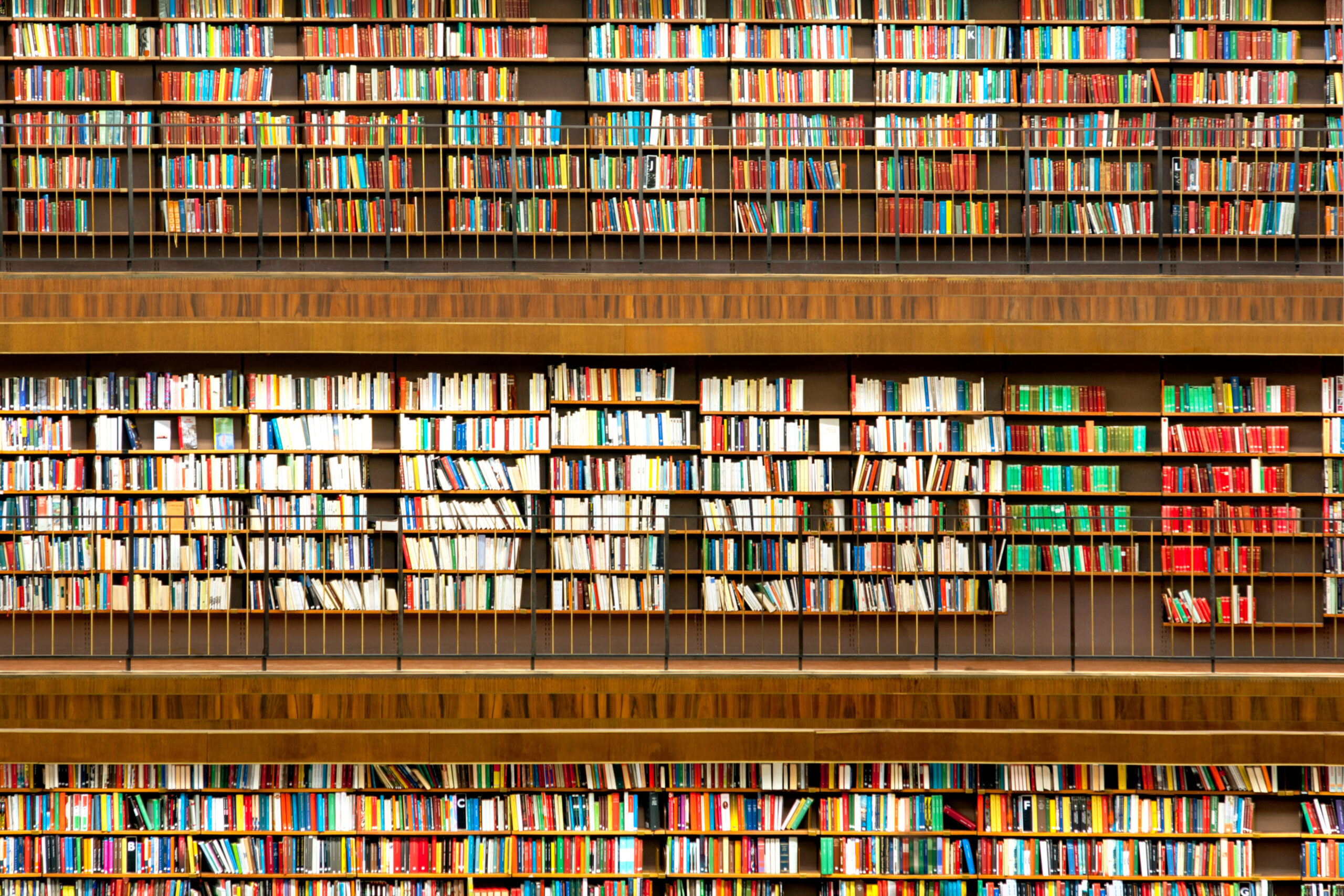Bernd Fichtner / Ohrbeck 2021
In diesem Beitrag werden historische und systematische Aspekte des Lesens und der aktuellen Leseforschung vorgestellt als theoretische Grundlage einer Fallstudie. Im Alltag verstehen wir Lesen als Tätigkeit eines Individuums, das einen Text still und leise für sich selbst liest. Lesen gilt neben (neben Schreiben und Rechnen) als eine wichtige und grundlegende Kulturtechnik; sie ist ein Teil der Kommunikation im Alltag. Um sich zu orientieren, muss man Schilder, Wegweiser, Beschriftungen von Verkehrsschildern lesen und verstehen können. Informationen, wie man sie in Büchern oder im Internet findet, setzten eine gute Lesefertigkeit voraus. Ein wichtiger Teilaspekt des Lesens ist oft die Reflexion, also das Überdenken des Gelesenen. Die erzählende Literatur (Unterhaltungsliteratur, Belletristik) erlaubt dem Leser sich in andre Zeiten und Personen zu versetzten und so Erfahrungen aus zweiter Hand zu sammeln. Auch im Blick auf Bilder benutzen wir das Wort Lesen.
Was meint nun aber Lesen als kulturelle Praxis eines Individuums? Darüber hinaus: Was bedeutet Lesen als kulturelle Praxis von Jugendlichen der Favela Sao Mateu in Sao Paulo?
In einem ersten Schritt werden im Folgenden kurz die wichtigen Etappen des Lesens, vor allem die historische Entstehung des stillen Lesens als Revolution mit ganz neuen Möglichkeiten der Thematisierung und Entwicklung der Subjektivität des Lesers vorgestellt. Hierzu gehören auch Formen des Lese-Verbots und der Bücherverbrennung. In einem zweiten Schritt wird allgemein die Lese-Praxis von Jugendlichen heute vor allem in Bezug auf die neuen Technologien der Information und Kommunikation (TIC) befragt. In einem dritten Schritt wird das Wohnen von Jugendlichen in einer Favela in Sao Paulo und der Bezug zu ihrem Erziehungs- und Bildungszentrum (CEU) zum Thema. Der Vortrag wird in einem vierten Schritt abgeschlossen mit der Skizze einer Fallstudie, basierend auf Methodologie der „Romantischen Wissenschaft“ (Lurija) und narrativen Interviews mit Jugendlichen dieser Favela in Sao Paulo.
- Zur Geschichte des Lesens
Die Entwicklungsgeschichte des Lesens ist eng mit der Geschichte der Schrift verbunden – ich beziehe mich hier vor allem auf die beeindruckende Die Studie des Argentiniers Alberto Manguel: Eine Geschichte des Lesens. Frankfurt/2012 [1]
Schrift und Lesen waren in einer historischen Perspektive eng mit der Weitergabe von Werten verbunden (nach Todd: Primogenitur). Durch die Alphabetschriften wurde Lesen wesentlich erleichtert. In der Antike und im Mittelalter wurde in der Regel laut gelesen. Griechische und römische Autoren beschreiben anschaulich die damalige Praxis eines langsamen und lauten Vorlesens, das wohl immer als ein Lesen „in Gesellschaft“, d.h. zusammen mit andern realisiert wurde.
Etwas leise und im Stillen für sich selbst zu lesen, stellt historisch eine Revolution dar, die m. E. in der aktuellen Leseforschung nicht adäquat thematisiert wird. Im Jahre 383 n. Chr. kam Augustinus von seiner Heimatstadt Karthago als 29-jähriger Lehrer der lateinischen Rhetorik nach Rom.
Eine Anekdote aus den „Bekenntnissen“ des Augustinus galt lange Zeit als Beleg dafür, dass das individuelle leise Lesen nicht als „normal“ galt: Augustinus berichtet, dass er seinen Mentor, den Bischof Ambrosius in Mailand beim leisen Lesen ertappt hätte, „wobei dessen Augen über die Zeilen geglitten seien, die Stimme jedoch habe geschwiegen (vox autem et lingua quiescebant)“. Augustinus drückt sein Erstaunen darüber aus und sucht nach Erklärungen…. Diese Beschreibung gilt als das erste gesicherte Beispiel für stilles Lesen in der westlichen Literatur (vgl. Alberto Manguel 2018, 71-79). Detailliert beschreibt Manguel wie durch neue Schreibweisen das stille Lesen in den Schreibstuben der Mönche erleichtert wurde.
Das stille Lesen ermöglichte dem Leser eine ungestörte Beziehung zum Buch und zum Wort. Die Mühe und die Zeit, die zum Aussprechen der Wörter erforderlich war, konnte er sich sparen. Dies motivierte die Vorstellungskraft des Lesers, das Gelesene mit seinem Wissen oder einem anderen vorliegenden Buch zu vergleichen.
Das Buch, das vom einzelnen Leser in stiller Lektüre aufgenommen wird, ist nicht länger Gegenstand sofortiger Erklärung oder Zensur durch eine Autorität. Das stille Lesen ermöglicht eine unkontrollierte Kommunikation zwischen dem Text und Leser und damit einen „einzigartige Stärkung des Geistes“, wie Augustinus es ausdrückte.
In dieser Epoche war das Lesen eines Buches eine kostspielige Angelegenheit, die nur wenige sich leisten konnten. Erst ab dem Hochmittelalter tritt eine Wende zum stillen, individualisierten Lesen ein. Zu erwähnen sind auch die ersten Universitätsgründungen. Das stille Lesen stört andere Kommilitonen nicht bei der Arbeit, ferner musste man niemanden preisgeben, was man las. Aus Zeitgründen kann ich leider nicht auf den Buchdruck, auf Martin Luther, das Lesen der Bibel und die Reformation eingehen.
Erst ab dem 16.Jh. setzte sich langsam die Veröffentlichung von Texten in der Landessprache und nicht mehr in Latein durch. Das Lesen wurde zuerst in den Städten dominant – (nicht unwichtig war auch die Erfindung der Lesebrille). Kaufleute, Juristen und Akademiker sahen das Lesen als eines ihrer Privilegien im Vergleich zu Bevölkerung auf dem Lande.
Erst im 18.Jahrhundert kann eine neue Tendenz festgestellt werden als Trend weg von religiösen Titeln zur Belletristik. Nicht mehr biblische, religiöse Themen waren dominant, sondern ein neuer Trend zu einer weltlichen Thematik – manchmal verbunden mit einer „Lesewut“ als Übergang von der vormals intensiven Lektüre hin zum extensivem Leseverhalten – das im Bildungsbürgertum des 19. Jahrhunderts seinen Höhepunkt findet.
Lautes Lesen hat sich als merkwürdige Ausnahme dennoch erhalten: In Kuba wurde den Arbeitern in den Zigarettenfabriken laut vorgelesen. In den 60er Jahren des 19. Jahrhunderts wurden solche Vorlesungen manchmal von den Arbeitern selbst bezahlt – und wurden manchmal vom Gouverneur Kubas verboten.
Ab Mitte des 19. Jahrhunderts erscheinen neue Medien (Fotografie und Phonograph – Kino, Radio und insbesondere das Fernsehen schwächen zunehmend die Leselust („Schaft das Fernsehen ab !!!°“?) (vielleicht einige Stichworte zur Geschichte des kleinen Bauerndorfes Südlohn im Münsterland an der holländischen Grenze, wo Bernd Fichtner aufgewachsen ist: …..)
Formen der Lese-Verbote bis hin zu den Bücherverbrennungen verstehe ich auch als Formen, die die politische Relevanz des Lesens ausdrücken. In Athen wurden 411 v. Chr. die Werke des Protagoras verbrannt. Kaiser Augustus trieb die Dichter Ovid und Cornelius Gallus ins Exil. Im Jahre 303 n. Chr. ließ der Kaiser Diokletian alle christlichen Schriften verbrennen. Im Jahre 1595 veröffentliche die römische Inquisitonsbehörde der Katholischen Kirche den erstem „Index der verbotenen Bücher“, in denen sie eine Gefährdung des Glaubens und der Moral erblickte. Der junge Goethe wurde in Frankfurt Zeuge einer Bücherverbrennung. Am 10. Mai 1933 wurden in Berlin vor mehr als 100 00 Zuschauern über 20 000 Bücher verbrannt begleitet von einer Ansprache des Propagandaminister Goebbels. (Vgl. Manguel 2012, Kap. Verbotenes Lesen, S.377-391).
- Das Lesen von Jugendlichem heute
Das Lesen heute ist oftmals ausgerichtet an anderen antrainierten Konsumgewohnheiten. Das Massenmedium Fernsehen mit seinen hundert Kanälen wird gegenwärtig anders konsumiert als zu der Zeit als nur drei Kanäle zur Auswahl standen. Das „Zappen“ steht im Vordergrund und so wird oft das Lesen auf unzähliche kleinste Happen aufgeteilt was wir oft öffentlichen Verkehrsmitteln finden und auch selbst realisieren. Ein Buch am Stück durchzulesen, scheint einen Luxus zu sein, den wir uns höchstens noch im Urlaub leisten können. Die neuen Technologien der Information und Kommunikation (TICs) spielen hier vor allem bei den Jugendlichen eine große Rolle.
In der aktuellen wissenschaftlichen vor allem erziehungswissenschaftlichen Diskussion über die Praktiken der Jugendlichen im Blick auf die TICs findet sich ein Moralismus, der vor allem die Gefahren, Laster usw., bei der Nutzung der TICs thematisiert. In diesem Diskurs findet sich eine gewisse Arroganz: Die Pädagogen wissen schon im Voraus, was ist gut und schlecht in der Praxis, wie jugendliche Nutzer des TIC damit umgehen. Selten findet man eine Position, die versucht, das radikal Neue in dieser Praxis der Jugendlichen zu beschreiben und zu verstehen z. B. in der Hypothese: Jugendlichen erobern und entwickeln in ihren kulturellen Praktiken des TIC, z. B. im Umgang mit dem Internet als sesshafte Nomaden, neue Dimensionen des Sozialen.
Jugendliche nutzen digitale Technologien als integralen Bestandteil ihres Lebens und lesen eigentlich dauernd: auf Websites, in sozialen Netzwerken, auf dem Smartphone, auf dem Tablet-PC etc. Diese massive Nutzung macht andere Denkmuster und Formen der Informationsverarbeitung notwendig: Das Nebeneinander von Bild und Text erfordert mehr Eigenleistung, um Zusammenhänge zwischen den einzelnen Textbausteinen herzustellen. Es gilt in dieser Altersgruppe zu beachten, dass Jugendliche sowohl ein reales als auch zum großen Teil virtuelles Leben haben.
- Lesen als kulturelle Praxis von Jugendlichen einer Favela und ihres CEU.s in Sao Paulo
Das Projekt soll realisiert werdet mit einer Gruppe von Adoleszenten in der Übergangsphase zum Jugendalter. Sie leben in einer Favela in Sao Paulo und besuchen tagsüber ein CEU oberhalb der Favela.
Das Vereinigte Bildungszentrum CEU war das Hauptprojekt des Sekretariats für Erziehung und Bildung der Stadt Sao Paulo in der Zeit zwischen 2001 und 2004. Es wurde in seiner Konzeptualisierung, Planung und Realisierung von der leitenden Direktorin für das gesamte Erziehungs- und Bildungssystem von Sao Paulo, Maria Aparecida Perez verantwortet, die darüber an der Universität Siegen eine beeindruckende Dissertation eingereicht hat
Ein CEU vereint es auf demselben geographischen Raum in einer Favela Schulen, die alle Altersstufen bedienen, ferner kulturellen Einrichtungen (Bibliotheken, Theater, Ateliers Computerzentren) sowie überdachte Sporthallen, Spielfelder, Skatparks, Schwimmbecken. Darüber hinaus kamen Angebote der sozialen Fürsorge.
Bis zum Jahresende 2004 wurden 21 CEUs gebaut, in Übereinstimmung mit der ursprünglichen Planung. Bis heute hat sich die Anzahl auf 45 erhöht, wobei die 24 zuletzt errichteten CEUs gewissen architektonischen Veränderungen unterzogen wurden. Der Planungsprozess selbst wurde durch komplexe Formen der Partizipation und Mitbestimmung der Favelados bestimmt.
Jede CEU- Einheit hat mit ihren ca. 13 000 Quadratmetern eine Tagestätte für 300 Kinder von 0 bis 3 Jahre, einen Kindergarten für 840 Kinder von 4 bis 6 Jahre, eine Grundschule für Kinder von 7 bis 14 Jahre und eine Abendschule für 1840 Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Außerdem gehören zu einem Zentrum ein Telezentrum, eine gemeinschaftliche Bäckerei, ein gemeinschaftliches Zentrum, eine Halle für Theater-, Musik- und Filmvorführungen mit 450 Sitzen, eine Bibliothek mit 20 000 Büchern, Musik- und Tanzräume, zwei Orchester (ein Streichorchester und eine Big Band), ein gemeinschaftlicher Radiosender, Multimedia Aufnahme- und Produktionsstudios, eine Kunstschule, eine Sporthalle, offene Sportplätze, Gras- und Sandfußballplätze, eine Skateboard-Loipe und 3 beheizte Schwimmbäder.
Zugleich ist jede CEU- Einheit einzigartig. Ihre Identität entsteht aus den Widersprüchen zwischen dem System und der jeweiligen Bevölkerung, also ihrer Besucher. Es existieren auch Widersprüche zwischen der eigenen Praxis von Bildung und Erziehung und der anderen Schulen. Zu nennen sind auch die Widersprüche zwischen der individuellen Erfahrung, den individuellen Kenntnissen und Wissensformen und den allgemeinen Wissensformen und Lebensformen unserer brasilianischen Kultur. Diese Widersprüche bilden ein Netz, besser ein Netzwerk für das Entstehen von Neuem.
In CEUs gehen Bildungsprozesse weit über die Schule mit ihren typisch auf den Klassen- oder Schulraum beschränkten Aspekten hinaus. Schule öffnet ihre vier Wände und bezieht sich in vielen Ebenen auf ein Gemeinwesen. In CEU wird die traditionelle Schule in einen Raum des Zusammenlebens, in ein Begegnungszentrum, einen Kulturraum mit ganz unterschiedlichen Aktivitäten verwandelt.
Die CEUs sollen dazu beitragen, dass die Individuen, die in diese Räume eintreten und sie sich aneignen, vor allem ihre eigene Identität finden oder ein Stück weiterentwickeln. Ein CEU wurde als ein Raum der Reflexion konzipiert, als ein Raum von Studien und gemeinsamer Entwicklung von Wissen, als ein Raum, um etwas über sich und die Welt, in der wir gemeinsam leben, zu erfahren.
Die CEUs agieren als Entwicklungspole für marginalisierte Gemeinwesen. Sie fördern die Integration der kulturellen Erfahrungen von Marginalisierten, sie übernehmen die Funktionen der Organisation und der Artikulation von sozialen Beziehungen in der einzelnen Favela. Die CEUs geben Kindern und Jugendlichen eine Chance, sich bewusst auf die eigene Kultur, Familie, Erziehung und Bildung, Sexualität zu beziehen und dabei die entwickelten Formen der neuen Kommunikations- und Informationstechnologie als Mittel zu handhaben.
- Fallstudie in Form partizipativer Forschung und in der Methodologie der „Romantischen Wissenschaft“ von Lurija
Bibliografie:
Illich, I. /Sanders, B. (1988): Das Denken lernt Schreiben. Lesekultur und Identität. Hamburg (Original San Francisco 1988).
Illich I./Sanders, B.: ABC. The Alphabetization of the Popular Mind. Editora North Point Press. San Francisco.
Lurija. A.R. (1993): Romantische Wissenschaft. Forschungen im Grenzbereich von Seele und Gehirn. Mit einem Essay von Oliver Sacks. Übertr. u. m. Anm. vers. V. A. Metraux. Reinbeck
Manguel, A. (2018): Eine Geschichte des Lesens. Frankfurt/M. (3. Auflage).
Markowitz, J. (1979): Die soziale Situation. Entwurf eines Modells zur Analyse des Verhältnisses zwischen personalen Systemen und ihrer Umwelt. Suhrkamp Verlag. Frankfurt.
Mander, J. (1979): Schafft das Fernsehen ab. Eine Streitschrift gegen das Leben aus zweiter Hand. Rowohlt 1979.
Perez, M. A. (2010): Soziale Inklusion durch Erziehung, Bildung und Kultur. Eine Studie über Programm und Realität der „Vereinigten Bildungszentren“ in Sao Paulo . Diss. Universität Siegen.
Sanders, B. (1998): Der Verlust der Sprachkultur. Frankfurt/M.
[1] Die Originalausgabe erschien unter dem Titel „A History of reading“ bei Alfred A. Knopf, Kanada, Toronto 1996. Die deutsche Erstausgabe erschien 1998 im Verlag Volk und Wissen. Berlin
Beitragsbild: pinkbadger